Ebenforstalm - Rundtour
4400 Steyr
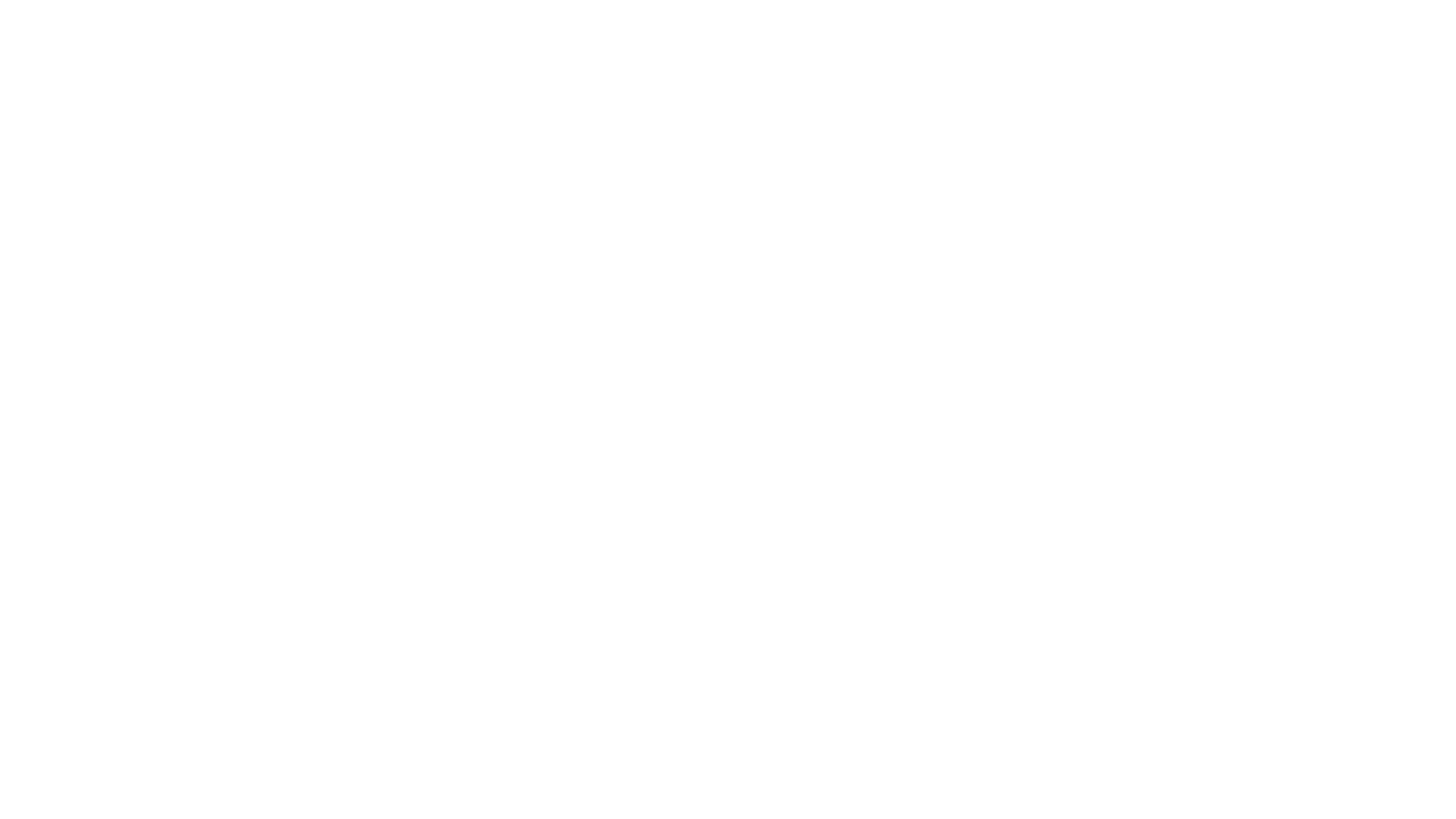
Parkplatz Weißenbach -Geisshanslniedern - Hausbach - links Boddinggraben - Messerer Häusl links - Ebenforstalm - Widen Graben - Parkplatz Weißenbach
Empfohlene Jahreszeiten:
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- Rundtour
Die Tour startet am Parkplatz Weißenbach und führt als erste Steigung hinauf auf die Geisshanslniedern. Danach geht es in den Hausbach bergab. Unten angekommen geht es links Richtung Bodinggraben. Beim Messerer Häusl links Richtung Ebenforstalm abzweigen. Die zweite Bergwertung beginnt und führt hinauf zur Ebenforstalm. Nach einer gemütlichen Einkehr geht es nur mehr bergab durchs Hintergebirge über den Wilden Graben und schließlich entlang des Großen Baches zurück zum Ausgangspunkt.Wegbeschreibung:
Die Tour startet am Parkplatz Weißenbach und führt als erste Steigung hinauf auf die Geisshanslniedern. Danach geht es in den Hausbach bergab. Unten angekommen geht es links Richtung Bodinggraben. Beim Messerer Häusl links Richtung Ebenforstalm abzweigen. Die zweite Bergwertung beginnt und führt hinauf zur Ebenforstalm. Nach einer gemütlichen Einkehr geht es nur mehr bergab durchs Hintergebirge über den Wilden Graben und schließlich entlang des Großen Baches zurück zum Ausgangspunkt.Sicherheitshinweise:
Erkundigen Sie sich vorab über etwaige Straßensperren entlang der Radroute und www.steyr-nationalpark.at.
Ausrüstung:Sonnen- und Regenschutz, Reparaturset für kleinere Radpannen, Stirnlampe.
Weitere Infos und Links:Kartenmaterial erhalten Sie unter www.steyr-nationalpark.at
Wegbelag:
Weitere Informationen:
- Rundweg
Details Mountainbike
- Fahrtechnik: schwer

1. Etappe: Anzenbach bis Wilder Graben
Ab der Hängebrücke führt der Weg durch den so genannten „Mesophilen Buchenwald“, der gut mit Wasser versorgt ist. Charakteristisch für diesen Waldtyp sind frische, lehmreiche Böden, die von Bingelkraut, Haselwurz und Waldmeister angezeigt werden. Die dominante Baumart ist die Rot-Buche, die sich hier besonders gut entwickeln kann und bis zu 40 Meter hoch wird. Die Strauchschicht ist meist schwach ausgeprägt. Durch das dichte Blätterdach dringt kaum Sonnenlicht auf den Boden, der meist von einer dicken Schicht rötlichem Buchenlaub bedeckt ist. Lediglich im Frühjahr, vor der Blattentfaltung, sorgen unter anderem Buschwindröschen, Bärlauch oder Leberblümchen für Blütenreichtum.
Alte Buchenwälder sind das Herzstück des Nationalpark Kalkalpen. Ihr Reichtum an Strukturen und Kleinlebensräumen sowie ein hoher Totholz Anteil sind ausschlaggebend für eine große Artenvielfalt. Hier fühlen sich Spechte und Totholzkäfer besonders wohl.

1. Etappe: Anzenbach bis Wilder Graben
Nicht nur ihre ursprüngliche Verbreitung über beinahe ganz Europa brachte der Rot-Buche diesen Namen ein, sondern auch ihre weit verzweigten Wurzeln, die bis in tiefe Erdschichten eindringen und für Stabilität sorgen. Das Buchenlaub verrottet zwar langsam, der so gebildete Humus sorgt aber für nährstoff reiche Böden. Rot-Buchenwälder gibt es nur in Europa, denn die Rot-Buche ist ein europäischer Endemit. Von Natur aus würden Buchen- und Buchenmischwälder die größte Fläche des europäischen Waldes einnehmen. Siedlungstätigkeit, Landwirtschaft und forstwirtschaftliche Nutzung drängten 80 % der ursprünglichen Buchenwälder allerdings zurück und naturnahe Bestände sind heute selten geworden.

Ein Stück weiter beschreibt eine Infotafel die beiden Buchenwaldtypen entlang des Weges. Nach einem Felsriegel dreht der Hang nach Süden und das Waldbild ändert sich nun vom Mesophilen Buchenwald zum sonnigen Trockenhang-Buchenwald.
1. Etappe: Anzenbach bis Wilder Graben
Hier entdeckt man Spuren einstiger forstwirtschaftlicher Nutzung. Jahrhundertelang wurde die Fichte zu Lasten anderer Baumarten bevorzugt. Man sieht aber eindrucksvoll, wie Laubgehölze aus der Umgebung in die Baumschicht vordringen. Zahlreiche der viel zu dicht stehenden Fichten sterben ab und aus einer Monokultur wird allmählich ein Mischwald.

1. Etappe: Anzenbach bis Wilder Graben
Eine Vielzahl an Gräsern säumt nun den Steig. Kennzeichnend für den Trockenhang-Buchenwald sind wärmeliebende Arten, wie Immenblatt, Schwalbenwurz, Efeu oder Immergrüner Seidelbast. Hin und wieder entdeckt man wildwachsende Orchideen, weshalb dieser Waldtyp auch Orchideen Buchenwald genannt wird. Zur Rot-Buche gesellen sich andere Laubhölzer, z.B. Echte Mehlbeere und Sträucher, wie Wolliger Schneeball oder Roter Hartriegel. Auch die Rot-Kiefer ist in geringen Anteilen beigemischt.

1. Etappe: Anzenbach bis Wilder Graben
Die natürlichen Wälder im Nationalpark Kalkalpen sind ein Mosaik an Keimlingen, Jungpfl anzen, kräftigen erwachsenen Bäumen, urigen Riesen und alten vermoder n den Stämmen. Diese Wälder sind durch ihre Vielzahl an Klein strukturen und ihren natürlichen Totholz Anteil enorm artenreich. Rund ein Drittel aller Waldorganismen ist im Laufe ihrer Entwicklung auf alte und tote Bäume angewiesen! Diese wertvolle Alters- und Zerfallsphase fi ndet man in Wirtschaftswäldern allerdings kaum, da die Bäume viel früher entnommen werden.
Alte, knorrige Bäume sind eine Welt für sich. Abgestorbene Äste bieten Lebensraum für Totholz bewohnende Insekten und dienen Vögeln bei der Nahrungssuche. Rindenverletzungen ermöglichen es Pilzen, den Baum zu besiedeln. Pilze erschließen das Holz für eine Vielzahl an nachfolgenden Tierarten als Nahrungsquelle. Baumhöhlen werden gerne von Vögeln als Bruthabitat genutzt. Nach jahrzehntelanger Nutzung entsteht am Boden der Baumhöhle so genannter Mulm, der sich aus zersetztem Holz und Vogelkot zusammensetzt. Auch hier gibt es hochspezialisierte Insekten, die diesen Lebensraum nutzen. Fleder mäuse wiederum brauchen abstehende Borke als Unterschlupf. Es wachsen auch sehr viele Moose und Flechten auf alten Bäumen. Aufgrund dieser hohen Strukturvielfalt werden solche Bäume als Habi tatbäume bezeichnet. Eine 200jährige Tanne beherbergt beispielsweise über 250 verschiedene Tierarten mit über 2.000 Individuen.

Auf einer kleinen Holzbrücke überquert man den Wilden Graben Bach. Nach etwa einer Stunde Gehzeit ist nun die erste Etappe geschaff t.
1. Etappe: Anzenbach bis Wilder Graben
Der Wilde Graben beeindruckt mit seinen steilen Flanken, tiefen Bacheinschnitten und totholzreichen Laubmischwäldern. Sechs Spechtarten, darunter Weißrücken-, Grau- und Dreizehenspecht, kommen hier in erstaunlicher Dichte vor. Vom großen Angebot der Spechthöhlen profi tiert auch der Halsbandschnäpper (Foto siehe nächste Seite oben).
Wilder Graben einst
Der Wilde Graben war schon früh von einem Weg erschlossen. Dieser führte von Reichraming über den Kohlplatz am Anzenbach, überquerte den Großen Bach und folgte dem Ostabhang des Zöbelbodens. Vom Wilden Graben ging es weiter zur Ebenforstalm oder den Großen Bach entlang zur Großen Klause. Um 1780 existierten zwei Klausen im Wilden Graben. Die Wälder wurden früher intensiv für die Reichraminger Hammerwerke genutzt. Die Schlagfl ächen und Wälder in diesem entlegenen Graben dienten einst sogar als Weiden. 1731 trieben zehn Bauern etwa 40 Stück Vieh auf. (Quelle: Weichenberger, 1995)

2. Etappe: Wilder Graben bis Große Klaushütte
Auf einer Geländekante hat ein Sturm im Sommer 2012 zahlreiche mächtige Buchen zu Fall gebracht. Mehr Sonnenlicht dringt nun auf den Waldboden. Das ist die Chance für eine neue, üppige Bodenvegetation mit Brombeere, Himbeere, Waldgeißbart, Brennnessel, Rossminze, Greiskraut, Flockenblume und Alpendost. Im Sommer tummeln sich Schmetterlinge auf der Waldlichtung, denn die Nektarbesucher schätzen das Nahrungsangebot der Hochstauden.

Die Talweitung Jaidhaus stellt ein in Oberösterreich einzigartiges Naturjuwel dar. 2016 wurde hier ein 319 ha großes Areal zum Naturschutzgebiet erklärt.
Der gesamte Talraum mit seinem teilweise auffällig ausgebildeten Buckelrelief sowie große Hangflächen wurden jahrhundertelang als Grünland genutzt.
Magerwiesen & Magerweiden sind mitteleuropaweit im Rückgang begriffen. Von den zahlreichen geschützen Arten und akut vom Aussterben bedrohten Pflanzenarten, sind im Naturschutzgebiet vor allem Große Sommerwurz, Kleine Hundswurz und Berg-Aster zu nennen.
Aulandschaft: Die Krumme Steyrling weist aufgrund nicht erfolgter Regulierungen eine starke Gewässerdynamik auf. Hier liegt eine Vielzahl völlig natürlicher Biotoptypen vor, vor allem Schotterbänke, Lavendelweiden- und Grauerlen-Auwald.
Fauna: Im Naturschutzgebiet konnten 7 Amphibienarten nachgewiesen werden.
Besonders in den halboffenen, stark strukturierten Hangzonen sind Neuntöter & Wendehals als seltene Brutvögel typisch.
Rückzugsgebiet für seltene Tagfalterarten wie Heilziest-Dickkopffalter und Lungenenzian-Ameisenbläuling, aber auch die seltene Schencks Sandbiene findet hier Lebensraum.
Anfragen & Mitteilungen zum Naturschutzgebiet: Land OÖ, Abteilung Naturschutz / n.post@ooe.gv.at

Rohrauer (8)
Am Reit-Erlebnishof "Rohrauer" bieten wir bundeszertifizierte reitpädagogische Betreuung für Kinder FEBS und genzheitliche Reitpädagogik GRIPS und individuellen Reitunterricht auf gut ausgebildeten Pferden und Ponys mit Reitpädagogin Karina. Wir bieten Kindergeburtstagsfeiern mit allen unseren Bauernhoftieren und lustige Thementage sowie Schule am Bauernhof - Exkursionen. Die ruhige und idylische Lage des Hofes lädt zum Verweilen ein.

Die 1999 renovierte Kapelle wurde 1928 erbaut, als das Messingwerk Reichraming hier ein Hammerwerk errichten ließ und immer mehr Arbeiterfamilien in das Dorf zogen.
Vor allem an Sonn- und Feiertagen war die Kapelle Mittelpunkt des dörflichen Lebens. Hier wurden Hochzeiten gefeiert und nach Todesfällen die Nachtwachen gehalten.
Wegen ihrer Göße war sie lange Ersatz für die Kirche, die in Reichraming erst 1897 erbaut wurde. Als ab 1960 die Bewohner wegzogen, hatte die Kapelle ausgedient.
Mit dem Pkw bis Parkplatz P4 Weißenbach und weiter zu Fuß ca. 20 Minuten am Nationalpark Themenweg "Im Tal des Holzes"
Bis zu 3 Stunden € 1,50/ 4 Stunden € 3,-/6 Stunden € 4,50/1 Tag € 6,- / 2 Tage € 9,- Minimale Parkdauer 2 Stunden
- Für Alleinreisende geeignet
- Mit Freunden geeignet
- Zu zweit geeignet
- Frühling
- Sommer
- Herbst
Für Informationen beim Kontakt anfragen.
Stadtplatz 27
4400 Steyr
Telefon +43 7252 53229 - 0
E-Mail reichraming@steyr-nationalpark.at
Web www.steyr-nationalpark.at/









